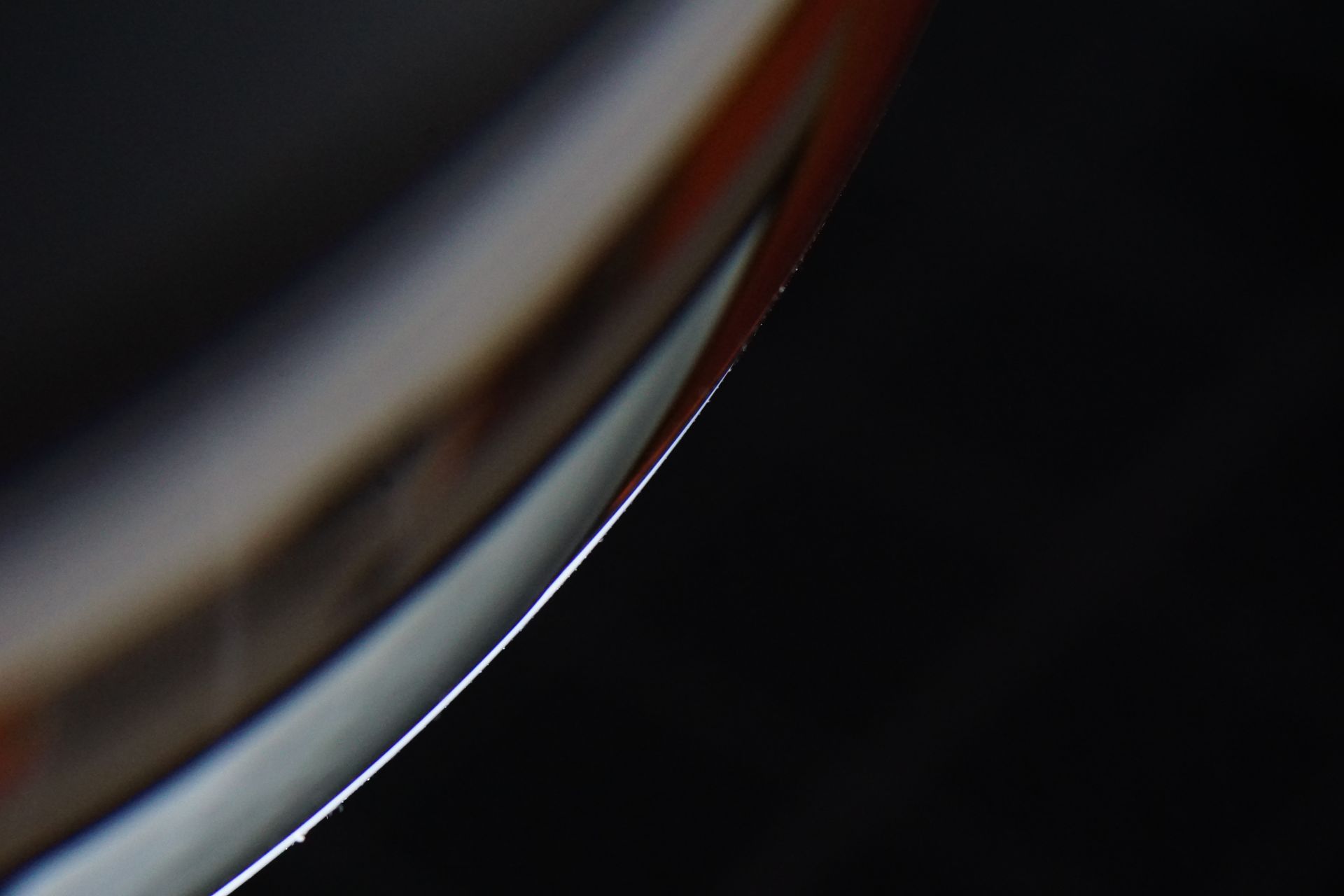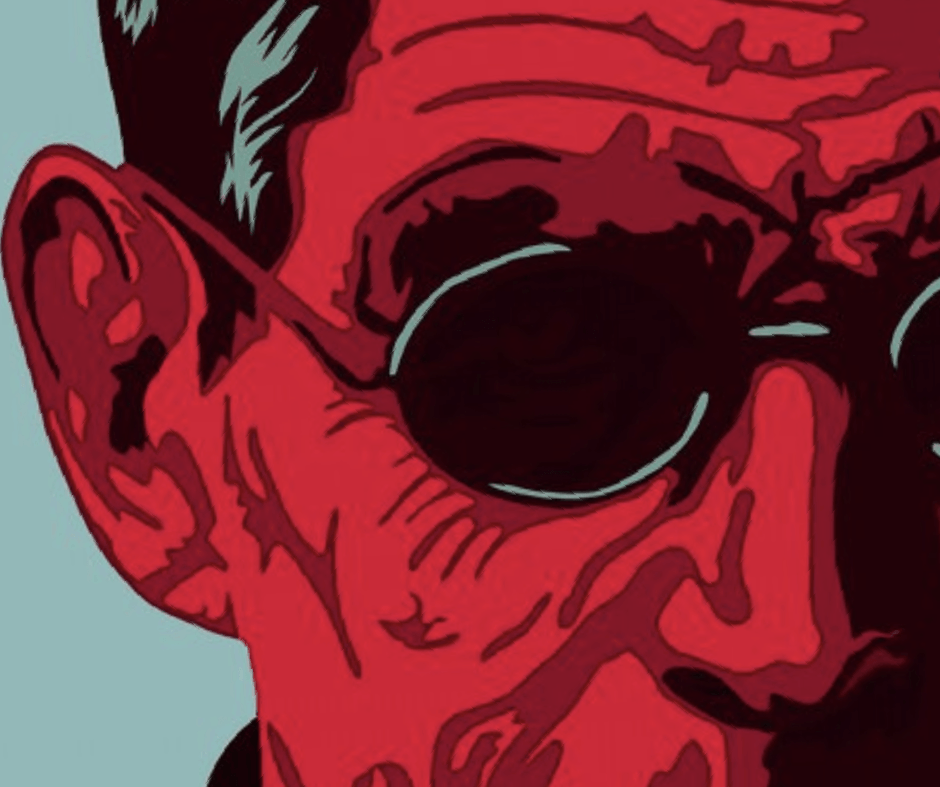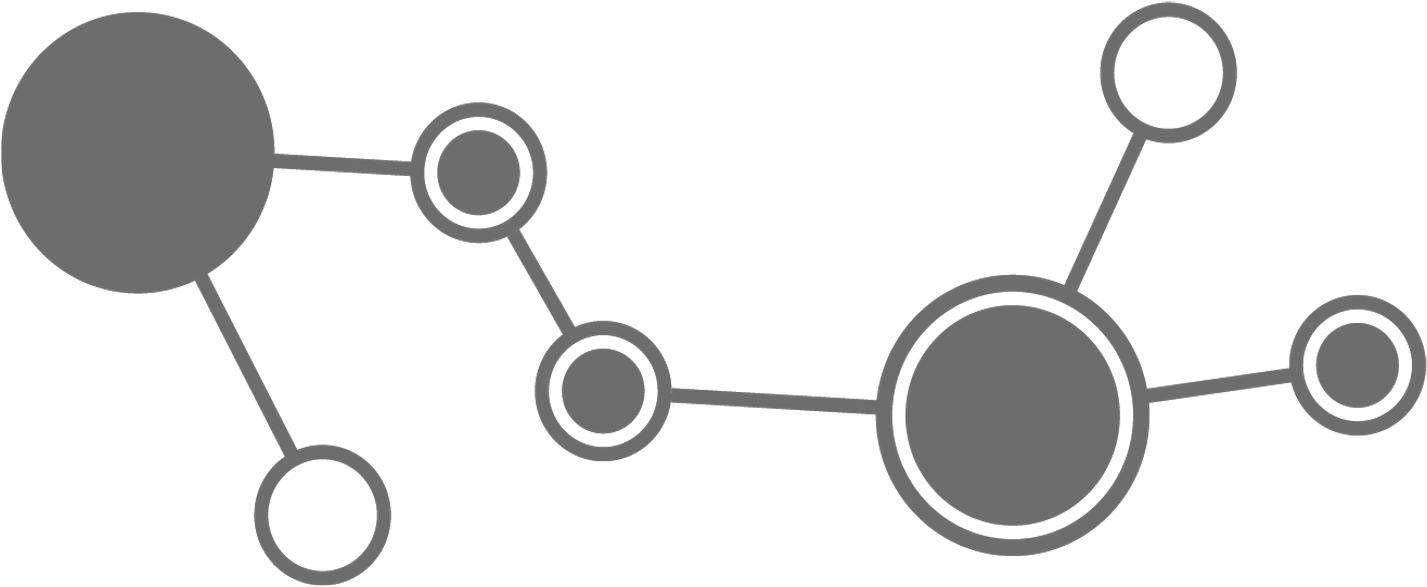Horizonte im ewigen Moment
Perspektive in Corona-Zeiten

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier; meine längst verblichene Oma glaubte womöglich an diesen altbekannten Spruch. Jedenfalls sagte sie, etwa wenn ich dagegen rebellierte in aller Frühe aufzustehen und in Schule zu gehen, oft: „Daran gewöhnst du dich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.“ Ein Tier zu sein, vielleicht ein Meerschweinchen, ein Wellensittich oder eine Katze, konnte ich mir vorstellen, zumal die nicht zur Schule mussten. Aber was, fragte ich mich, ist ein Gewohnheitstier? Tat ein solches Tag für Tag, Stunde um Stunde das genau Gleiche?
Zeit meines bisherigen Lebens habe ich versucht, mir keine Gewohnheiten zuzulegen, doch nun ist etwas passiert, an das nicht nur ich mich nicht gewöhnen kann. Wir sitzen in unseren Selbstisolationshaftanstalten, jede und jeder in seiner und seinem. Wir haben uns von unserem jeweiligen „alten“ Alltag verabschiedet, den „neuen“ aber nicht begrüßt; der hatte und hat nicht Begrüßenswertes. Wir waren und sind bemüht, uns an diese absurd-unsoziale Existenzform zu gewöhnen, sie irgendwie zu strukturieren. Das vollzieht sich in Etappen oder Phasen. Zunächst hofften wir, der Corona-Kelch möge an uns vorübergehen, sich jedenfalls nicht in seiner ganzen Fülle über uns ergießen; dies hofften auch andere Völker – ebenso vergeblich. Dann erlebten wir unsere Regierung aktionistisch wie selten zuvor. Maßregeln wurden erlassen und Verbote, Empfehlungen, Weisungen, Richtlinien erteilt – und Ratschläge gegeben, die sich tatsächlich wie Schläge aufs Gemüt anfühlten; eine schier unüberschaubare Menge von Informationen zu Covid 19 prasselte auf uns nieder. „Man traut sich ja nicht mal mehr, eine Dose Fisch zu öffnen“, sagte meine Nachbarin. Die Nachrichten von Tausenden Toten und schweren Krankheitsverläufen verstörten uns zutiefst. Aus Mangel an professionell gefertigten Mundschutzen (schon dieser Plural ist ein Graus) flickten wir uns selbst welche zusammen und laufen nun, falls wir uns überhaupt hinauswagen, mit diversen Gesichtsbinden, die mich tatsächlich an diese Damenhygieneartikel erinnern, durch nahezu menschenleere Straßen, doch bestenfalls zum nächsten Supermarkt, wo wir anfangs vor allem Toilettenpapier, Grundnahrungsmittel und Konserven kauften, aber bald auch Bier-, Wein- und Schnapsflaschen in „nicht üblichen“ Mengen. Ich (und gewiss nicht ich allein) bedauerte die Obdachlosen, die ich, seit ich des Öfteren von Polizisten nach Wohnort und Ziel befragt wurde, schon fast beneiden wollte, um ihre unfreiwillige Freiheit; zumindest den Gedanken kann ich mir, obwohl er arg zynisch ist, nicht verkneifen. Während der ersten Tage des jetzigen Zeitalters lächelten wir Passanten einander gelegentlich an, so, als wären wir nicht sicher, ob wir uns jemals wiederbegegnen würden. Inzwischen aber weicht mir jeder meine kurzen Wege kreuzende Mitmensch in großem Bogen aus, hält den Kopf gesenkt, vermeidet Blickkontakt. Nur die Kinder und die Hunde an ihren Leinen verhalten sich etwas unbefangener. Wir verstehen, dass sie nicht verstehen, was los ist; gut, die Kinder vielleicht ein bisschen. Und wir fragen uns, ob wir es verstehen.
Es ist Frühling geworden, die Sonne scheint und wärmt, sogar durch die Fensterscheiben, an denen Krähen und Tauben vorüberfliegen, die Bäume schlagen aus, die Tulpen setzen zur Blüte an, die Amselhähne sitzen morgens laut zwitschernd auf den Mobilfunkantennen. Wir Großstädter beobachten all das von drinnen, hätten gerne einen Garten, ein ahnungsloses, aber freundlich um uns herumwuselndes Haustier, einen Hund, eine Katze oder zwei, drei Goldhamster. Denn das Letzte, was mich zum Lachen brachte, war eine Karikatur zum Thema Hamsterkäufe: Ein Mann schiebt einen Einkaufswagen voller kleiner, quirliger Hamster vor sich her und in der Denkblase über seinem Kopf steht: So, nun habe ich für ne Weile genug Gesellschaft.
Ja, diese Pandemie wird abklingen, wir werden wieder überall hin und zur Arbeit und sogar reisen dürfen. Aber wird es eine (genauer unsere) Welt, die, die wir kannten, nach Corona geben? Eine Welt vor Corona gab es ja auch nicht, denke ich – und dann an einen hochphilosophischen Witz, den ich einst in Boston, am berühmten MIT (Massachusetts Institute of Technology) hörte. Zwei Planeten, A und B, deren Umlaufbahnen sich in der Einsamkeit des Weltraums alle Dreißigmilliarden Jahre kreuzen, sausen nach eben dieser Zeit aufeinander zu. Wie geht’s, fragt Planet A seinen Planetenkumpel B. Schlecht, antwortet der als sie gleichauf sind. Warum? ruft, schon weiterrasend, Planet A. Ich hab Homosapiens, ruft B. zurück und vernimmt dann aus der Ferne, doch gerade noch hörbar, den Trost des Planeten A.: Behalt die Nerven. Das geht vorbei …
Katja Lange-Müller, April 2020
© für die Laterale e.U.